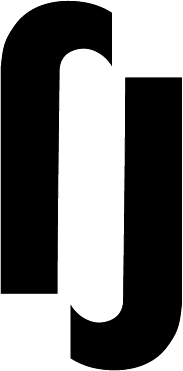Unfassbare Fremdheiten
Gedanken und Überlegungen zu einem anderen Verständnis in der psychoanalytischen Behandlung.
Als eines Tages die Türglocke meine Abendstille schrill zerriss und ich mich mit einer angstvollen Ahnung schweren Schrittes zur Tür aufmachte, musste ich mich zwingen, nicht die Flucht zu ergreifen. Ich befand mich in einer befremdlichen Szene. An der Tür stand zu später Abendstunde ein Freund, den ich nicht erwartete. Zitternd, mit wirren Augen, wie ein verwundetes Tier stand er vor mir, sprach Merkwürdiges und Fremdes, Intonation und Mimik waren fremd wie von einem anderen Stern, so eine Art Alien. Angst um ihn und um mich erfassten mich, Worte gelangen mir nicht, nicht mal stammeln. Ich konnte gerade noch die Hand nach ihm ausstrecken, um meinem Impuls, die Tür zuzuknallen, zu unterbinden. Er ergriff die Hand und eine blinde Spur des Wiedererkennens verband uns zaghaft. Im geschützten Innen erzählte er verworren über seine Verfolgungsfantasien, Todesängste, der Vater wolle ihn erschießen und andere paranoiden Inhalte, eine Mischung aus Horror- und Fantasiefilm.
Innen hing ein Spiegel, in den ich ab und an während seiner Rede schaute, um mich zu betrachten, mich wieder zu erkennen, bei mir zu bleiben.
Irgendwann schaute er auch in diesen Spiegel, wie gebannt, zentriert, schaute auf ein Zerrbild von sich und in diesem Moment zerbarst der Spiegel unter Getöse in seine tausend Einzelteile, sprengte seinen Rahmen und ließ uns mit einer Angst zurück, die mir unbeschreiblich ist. Aber in diesem Moment des Todesschrecks verstand ich ihn. Mir schien, dass wie der Spiegel seine Seele zersprungen war in dem Moment, in dem er sich erblickte und ihm seine Fremdheit bewusst wurde. Diese Fremdheit hatte von ihm Besitz ergriffen, wir waren zwei Fremde in einer fremden bedrohten Welt. Dort blieb ich mit ihm über lange Zeit bis wir Teile von uns wiederkannten, Vertrautes zurückkehrte. Er konnte begreifen, dass er Hilfe benötigte und er stimmte einer stationären Behandlung zu.
Bei meiner Beschäftigung mit dem Fremden fühlte ich mich plötzlich wie in einem Dschungel umgeben von einem Dickicht aus Begriffen und Konzepten. Ich war umringt und umstellt von Begrifflichkeit durch ich mich mühsam, aber auch voller Neugier hindurcharbeitete.
Ich begegnete:
dem Eigene, dem Fremden, dem Ich, dem Nicht-Ich, dem Anderen, dem Unbekannten, dem Selbst, dem Nicht- Selbst, dem Unheimlichen, dem Schatten.
Ich beginne mal mit Freud. Er spricht nicht direkt vom Fremden sondern vom Unheimlichen. In seiner Schrift Das Unheimliche weist er daraufhin, dass wir Analytiker an den Schichten des Seelenlebens arbeiten, die mit zielgehemmten und gedämpften Gefühlsregungen zu tun haben, mit dem Unheimlichen, Schreckhaften, Angst- und Grauenerregendem. Also mit den unheimlichen Aspekten des menschlichen Lebens, die eigentlich im Verborgenen, die ein Geheimnis bleiben sollen, dann aber doch plötzlich und unverhofft hervortreten. Das Fremde oder Unheimliche ist damit dem Unbewussten gleichzusetzen oder zumindest ein Aspekt davon.
Otto Rank meint, dass das Fremde und Unheimliche und unsere Angst davor nichts weiter sei als die kraftvolle Dementierung der Macht des Todes. Letztlich ist das Fremde immer der Tod, der uns so ängstigt, dass wir ihn verleugnen müssen.
Jung benennt als Schatten jenen Teil, den der Mensch bei sich ablehnt, der er nicht sein möchte. Sozusagen die negative Seite der Persönlichkeit, die dunkle Seite, die man lieber verbirgt als bekennt. Der Schatten begegnet uns in Träumen in vielerlei Gestalt.
Gruen sieht Fremdheit, er personalisiert die Fremdheit und spricht vom Fremden, als den Teil des Menschen an, den wir alle in uns tragen, der uns aber irgendwann abhanden gekommen ist. Nun versuche jeder Mensch diesen abhanden gekommenen oder verlorenen Teil wieder zu finden. Das macht jeder auf seine Weise, der eine ringt mit sich selbst, der andere zerstört dafür Lebewesen. Gruen ist ein moderner Moralist, denn er sieht in unserer Kultur eine tiefgreifende Unterdrückung und Ablehnung des Kindseins. Kinder, die den Erwartungen der Eltern nicht entsprechen, werden mit offener und/oder verdeckter Zurückweisung bestraft. Das Kindsein steht immer in einem Konflikt mit dem Erwachsein. Das Kindsein und das Erwachsensein bilden keine Ergänzung, sondern Gegensätze, werden als solche wahrgenommen und so behandelt. Das Kind ist Opfer, darf sich aber nicht als Opfer erleben, weil ja alles aus Liebe und zum Besten des Kindes geschieht. Das Opfersein wird damit zur Quelle eines unbewussten Zustandes. Das eigen Erlebte wird als etwas ausgestoßen und muss verleugnet werden. Dieser verdrängte Teil, der aus dem Bewusstsein ausgeschlossen wird, wird nun aber wiedergesucht werden, er soll und muss wiedergefunden werden.
Andere Autoren wie Clausen, Boesch oder Erdheim gehen vom Fremdeln des Kindes aus und betonen, dass das Kind beim Fremdeln noch nicht zwischen Eigenem und Fremden unterscheiden kann, da es sich gerade erst aus dem Zustand der Objektlosigkeit löst. Das Kind trennt zunächst nur zwischen dem Vertrauten und dem Unvertrauten. Diese Unterscheidung wird durch den Wiederholungszwang hergestellt. Alles sich Wiederholende ist vertraut, alle neu Auftretende ist unvertraut.
Der Ausgangspunkt für die Entwicklung der Beziehung und Einstellung zum Fremden bildet sich dann, wenn das Kind beim Zusammentreffen mit dem Fremden starke körperliche Reaktionen zeigt (erstarrte Mimik, Pupillenerweiterung, Versteifung des Körpers, erhöhter Puls- und Herzschlag, Angstanzeichen). Das Kind wird dann immer mobiler und erkundet seine Umwelt, die ambivalent zwischen Angst und Lust geprägt ist. Das Neue ist durch die Abwechslung lustbringend, es evoziert aber auch Angst und Vorsicht. Die Welt zerfällt in den sicheren und langweiligen Bereich des Eigenen und den des ängstigenden und spannenden Fremden. Dieser Vorgang ist von vielen Rückschlägen geprägt, weil das Kind feststellen muss, dass das Verlassen des Vertrauten um vieles leichter fällt als die Rückkehr zu diesem.
In seiner primitivsten Form ist das Fremde die Nicht-Mutter. Diese Fremdenrepräsentanz ermöglicht dem Kind, eine Beziehung zu der Person aufzunehmen, die nicht seine Mutter ist. Das Kind beginnt seine Umwelt in die Bereiche des Eigenen und des Fremden zu strukturieren.
Ich bin überzeugt, dass wir das Fremde benötigen, weil Fremdheiten nötig sind, damit sich das Ich konstituieren kann. Zur Bildung des Ich ist das Fremde ebenso nötig wie das sich davon abgrenzende Eigene. Ein Verlust des Fremden würde unweigerlich zum Verlust des Eigenen führen. Die Folge wäre eine ständige Selbstbegegnung. Eine Höllenverdammnisvorstellung dem unbegrenzt Eigenen ausgesetzt zu sein. So betrachtet ist die Angst des Menschen vor dem Fremden nicht die Angst vor dem Fremden an sich, sondern vielmehr die Angst davor, dass eben dieses Fremde verschwinden könnte.
Ein weiterer Gedanke, der sich mir aufdrängt, ist der, ob sich unfassbare Fremdheiten überhaupt fassen lassen? Und selbst wenn es gelänge, wären sie dann nicht von ganz anderer Qualität? Verlöre die unfassbare Fremdheit, verlöre das Fremde nicht seinen ureigenen spezifischen Charakter. Es wäre dann ein fassbar Bekanntes und damit ginge ein Teil von mir selbst verloren. Was aber gewinnen wir, was würde uns bereichern, wenn wir eine Qualität zerstören, die das Beunruhigende und das Unheimliche des Fremden in ein Bekanntes konvertiert? Schützen wir uns wirklich vor einer Beunruhigung, indem wir sie vereinnahmen?
Natürlich konfrontiert uns das unfassbare Fremde mit einer ungeheuren Radikalität. Natürlich fordert uns dieses radikal Fremde heraus, weil wir hinnehmen müssen, dass es keine innere und/oder äußere Welt gibt, in der wir völlig heimisch und identisch sind. Nehmen wir diese Herausforderung an oder verdrängen wir, dass wir niemals Herr/Herrin im eigenen Hause sind?
Wie gestaltet und zeigt sich das unfassbar Fremde in der therapeutischen Beziehung, im therapeutischen Raum an dem Therapeut und Patient beteiligt und zugegen sind? Welche neuen Ansätze des Verständnisse und des Umgangs sind möglich?
Das Fremde zeigt sich/ offenbart sich uns in vielfältiger Maskierung. (Maske aufsetzen) Form und Gestalt. Es taucht plötzlich auf, unerwartet, zeigt sich im Flimmerlicht ängstlicher Augenblicke, lauert hinter Ecken und Toreinfahrten, überfällt uns gnadenlos.
Neben dem ängstigenden Fremden kennen wir aber auch alle unsere Lust an der Verfremdung, an der Verkleidung, ein anderer sein zu wollen, eine Andersartigkeit anzunehmen, die uns fremd und lustvoll erscheint (Haarperücke, Nase). Beide Seiten des Fremden sind uns allen aus den verschiedensten Bereichen unserer Lebenserfahrung bekannt.
Wie auch immer das Fremde sich uns zeigt, uns konfrontiert, sich gestaltet, es erfordert und erzeugt immer eine affektive Antwort. Auftauchende Fremdheiten und affektive Antworten und oder Reaktionen bilden ein Paar. Die Verleugnung oder der Hass auf das Fremde sind damit immer auch eine Verleugnung oder eine Projektion dieser affektiven Ladungen. Sie werden dann dem Fremden als solchem zugeschrieben, sind aber eigene persönliche innere affektive Antworten. Der Hass auf das Fremde entsteht nicht durch das Fremde an sich, sondern ist die eigene Angst, die in Hass verwandelt wird, um das Fremde zu bekämpfen oder zu eliminieren. Das Eliminieren des Fremden erfolgt mit verschiedenen Spielarten. Eine besondere infame Spielart ist der moralische Appell der Akzeptanz, der Integration, der Verleugnung: es gibt nichts Fremdes, alles ist verstehbar, also die Flucht in die Omnipotenz, um das Fremde zu entsorgen. Der spielerische Umgang mit dem Fremden ist da eine reifere Form, sich mit den Fremdheiten auseinanderzusetzen. Sie eben gerade nicht zu fassen, sondern sie in ihrer Unfassbarkeit anzuerkennen. Beraubt man das Fremde seiner Eigenart, nämlich seiner Unfassbarkeit, macht man es zu einer belanglosen Gefühlsoase und vernichtet Teile seiner Existenz.
Das Fremde emotional zu neutralisieren, heißt es zu kastrieren. Ich plädiere für eine Zuwendung zum Fremden, die affektive Beunruhigung im Patienten und im Eigenen hinzunehmen in der Gewissheit, das niemals alles verstanden werden darf. Ich nenne das das Glück der Ratlosigkeit. Ich bin überzeugt, dass sich andere innere Antworten ergeben, wenn wir unseren affektiven Reaktionen trauen, ihnen Raum geben und uns damit vor Verleugnungstendenzen schützen, die den therapeutischen Prozess einengen oder gar verhindern. Die innere Konflikthaftigkeit, die sich im Auftauchen von Fremdheiten findet, lässt sich nicht durch Beruhigungsrituale, durch Verharmlosungspillen oder durch Theoriegebäude abschaffen, sondern erfordert Mut, sich des Fremden auszusetzen. Sich des Fremden zu bemächtigen, es zu kontrollieren, führt zur Unterdrückung, aber das Fremde will leben, seine Existenz will anerkannt sein.
Mich des eigenen Fremden, wie des Fremden meiner Patienten auszusetzen, es rückhaltlos anzuerkennen, meine inneren affektiven Antworten zu finden und diese einzusetzen, ist ein mühevoller, aber lohnender Weg.
Jeden Tag tauchen Situationen, Gedanken, Fantasien in den Behandlungen auf, in denen unheimliche Fremdheiten zur Sprache kommen, sich in Bilder ergießen oder sich in Schweigeabgründen offenbaren. Sie können dann mein Erleben ergreifen und wenn ich ihnen nicht ausweiche, nehmen sie mich ganz in ihren Besitz, dringen in mich ein, erschüttern, verwirren, überfluten mich.
Die Entdeckung des Fremden führt zu einer emotionalen Erregung und fordert meine Antwort. Triebängste, diffuse Erregungspotentiale, ungeahnte Affektintensitäten werden hochgespült, Irrationalitäten treten zutage.
Fremdes und Fremdheiten sind immer in uns selbst und zwischen uns. Sie sind weder eine zukünftige Offenbarung, deren Einverleibung alles zum Guten wendet noch ein direkter furchtbarer Gegner, den es auszulöschen gilt. Es ist die verborgene unbekannte oder auch die gefürchtete und gehasste Seite in uns, der uns fremde Teil unserer Identität. Das Fremde macht den eigenen Innenraum und den relationalen Zwischenraum, unsere gemeinsame Bleibe zunichte. Verständnis und Sympathie/Empathie gehen zugrunde. Erkennen wir das Fremde in uns, verhindern wir, dass wir uns selbst verabscheuen und unser Gegenüber.
Es kommt eine 30jährige sehr attraktive Frau in meine Praxis auf Empfehlung ihres plastischen Chirurgen. Mein erstauntes Gesicht nimmt sie wahr und erläutert, sie wisse sehr wohl, dass sie eine Schönheit sei, edel geformt, alle würden ihr das bestätigen. Sie habe auch als Modell gearbeitet, aber sie erkenne sich nicht. „Ich schaue in den Spiegel und sehe nicht die, die ich bin, sondern ein anderes, ein fremdes Wesen. Ich erschrecke, weil ich mir verloren gehe.“
Auch ich erschrecke über das Fremdheitsgefühl. Was passiert, wenn ich morgens aufwache und ich mich nicht wiederkenne? Ein Fremdes schaut mich an. Sich wiedererkennen im Spiegel oder in sich ist eine Voraussetzung, um sich dem Fremden zuzuwenden. Wiedererkennen und Fremdheit bilden einen Zusammenhang. Nicht immer erkennt man sich wieder, das kennt jeder von uns.
Sie hat sich von der Außenwelt abgeschottet, hasst die Menschen ihrer Umgebung, hasst sich und ihren Körper, weil er ihr fremd ist. Sie fühlt sich von ihren Primärobjekten manipuliert. Die Mutter nimmt sie mit in ihre ärztliche Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten und zeigt ihr an lebenden Personen die Auswirkungen sexueller Ausschweifung, sie wird von Bildern der Fremdheit überflutet. Der Genitalbereich wird zu einer angstvollen, infizierten, wunden, stinkenden Kloake. Der Vater als kaltrechnender Ingenieur will sie ganz für sich, umgarnt sie mit entwertenden Botschaften. Sie soll nach seinen Vorstellungen ihr Leben gestalten.
Die Elternimagines fordern Unterwerfung und Beschneidung erahnter Eigenimpulse, es entstehen Fremdheitsgefühle, diese werden dann aber ignoriert, übergangen. Es gibt sie nicht.
Die erlebte Auslieferungstotalität führt zu einer Unterdrückung des Eigenen, das als Fremdes erlebt wird und zu einem verborgenen Hass, der Vernichtungsfantasien stimuliert, die ein verborgenes Schattendasein führen, immer auf der Lauer nach Beute. Ich spüre diesen lauernden Schatten zunächst als eigene diffuse Innenbeunruhigung.
Die unverarbeiteten narzisstischen Kränkungen der frühen Objekte können den kindlichen Selbstschöpfungsfantasien keinen Raum zubilligen. Das Eigene wird zu etwas Fremden, das vernichtet werden muss. Das Aussehen, die Kleidung, die Kontakte werden vorgeschrieben. Abweichungen sind mit Strafe, Missachtung, Liebesentzug, Drohung und Gewalt belegt.
Die Patientin entwickelt sich zu einer Marionette, die sich ihren Erzeugern unterwirft. Unterwerfung wird zum Lebensentwurf. Als Vorführdame macht sie sich zum entfremdeten Objekt von Modeschöpfern, folgt willig den Anweisungen anderer Menschen, wird zur Gespielin, eine willfährige Puppe. Sie verliert sich selbst mehr und mehr, reagiert mit Panik und massiven Selbstverlustängsten als ihr Beschützer/Beherrscher ihrer überdrüssig wird. Sie entwickelt heftigste Symptome wie Angst, Unruhe, Schlaflosigkeit und paranoide Ideen.
In ihrer größten inneren Zerfallsnot, als sie sich im Spiegel nicht mehr erkennt, kreiert sie ihre Selbstrettung, ihre Selbsttherapie. Sie entwirft für sich einen eigenen Selbstschöpfungsmythos. Sie erschafft und formt sich selbst.
Ich habe lange gebraucht um aus einer grauschattigen Welt, in der alles verschwimmt, in der ein graues Rauschen vorherrscht, in der ich mich und die Patientin als Fremde in einer fremden Welt erlebt habe, herauszufinden. Ich verstehe ihren Wunsch, sich einen eigenen, belebten Körper zu erschaffen, ein Modell ihrer selbst als Überwindung des Fremden. Sie fertigt ein Schnittmusterbogen von sich. Dabei greift sie auf ein Kinderbild von sich zurück, sie ist 3 Jahre alt, später zeigt sie es mir.
Bei allen meinen Patienten fand und finde ich diesen Selbstschöpfungsmythos oder diese Selbstschöpfungssehnsucht mehr oder minder stark ausgeprägt. Sie trägt immer einen leiblichen Anteil. Niemanden fand ich bisher, der mit seinem Körper, der mit seiner Körperlichkeit übereinstimmte. Meine Erkundungsfahrten hinsichtlich des Selbstschöpfungsmythos führten mich unter anderem zu einem Text von Lacan aus dem Jahre 1949. Dieser Text hat mich dabei besonders berührt. Lacan verdeutlicht in diesem Text die Schlüsselfunktion des Imaginären, des Fremden für die Konstitution und die Bildung der Identität in seiner Theorie des Spiegelstadiums. Damit bezeichnet er die Phase zwischen dem 6. und 18. Monat in der Entwicklung des Kleinkindes. Hier sind die Kinder in ihrer Motorik noch unterentwickelt und abhängig von der Fürsorge der Primärobjekte. Diese Ohnmächtigkeit schafft die Notwendigkeit eines überhöhten Ideal-Ich. Dies bildet sich im Spiegel (realer Spiegel), in dem der Säugling sich selbst als einen vollkommen und begehrenswerten anderen (v)erkennt. Das Kind sieht sich zum ersten Mal in seiner Gesamtheit, es nimmt sein Gesicht und seinen Körper als Gesamtes wahr. Es entwickelt sich ein ganzer Bereich des Bildhaften innerhalb der Psyche.
Das Subjekt bildet sich also aufgrund einer narzisstischen Täuschung, indem es sich auf einer fiktiven Linie situiert, sich auf ein zukünftiges Ideal hin antizipiert. Das gleicht einem Sprung heraus aus der kontinuierlichen Raum-Zeit, es ist ein Bruch im Individuum entstanden, das Subjekt ist gespalten. Das Spiegelstadium ist die symbolische Matrix der Ich-Bildung, die noch vor der Identifikation mit einem realen Anderen und vor der sprachlichen Bildung stattfindet. Die totale Übereinstimmung mit dem idealen Spiegelbild, dem perfekten Doppelgänger, dem alter ego, kann jedoch niemals hergestellt werden. Die Spaltung des Ich macht für Lacan die immerwährende paranoide Gefährdung des Subjekts aus, dessen Identitätsstrukturen ja stets abhängig von den Fiktionen des Spiegels, also des Scheins und der Oberfläche bleiben. Diese Angst zeigt sich z. B. in Träumen von zerstückelten oder gepanzerten Körpern. Der Versuch die biologischen Grundlagen von realer Abhängigkeit, Hilflosigkeit und Bedürftigkeit in die psychische Struktur einzuschreiben ist ein unmöglicher Versuch, der ständig wieder unternommen werden muss, damit das Subjekt aus den Verstrickungen des Imaginären herausfindet und das Ideal-Ich eben nicht zu einem inflexiblen Panzer verkommt, der die Weiterentwicklung des Subjekts verhindert und möglicherweise die Beziehung zu einem realen Anderen verhindert. Das Ideal muss verflüssigt, der Knoten imaginärer Knechtschaft gelöst werden, was bei Lacan durch die Vorbildfunktion des Vaters, einer dritten Instanz außerhalb der symbiotischen Mutter-Kind-Beziehung, geschieht. Dieser Dritte führt das Subjekt in die Sprache ein, die für Lacan die wesentlichste Form des Symbolischen ist. Das Subjekt bildet sich an einer Imagination, einer Wunschvorstellung, einem aufs Visuelle reduzierten Identifikationsobjekt, das zugleich Ich und ein Anderer ist, fremdes unerreichbares Objekt eines Begehrens, welches der ursprüngliche Mangel in Gang setzt. Da die symbolische Ordnung nicht dafür gemacht ist, feststehende Identitäten zu vergeben oder letzte Worte zu sprechen, ist an eine dauerhafte Position im Symbolischen nicht zu denken. Das Subjekt muss sich also immer wieder erneut den Weg aus dem Chaos vorsymbolischer Undifferenziertheit in die symbolische Welt klarer Grenzen und Zuschreibungen bahnen. Das geschieht ohne Ausnahme auf der Basis der Strukturen, die sich im Spiegelstadium gebildet haben.
Das Fremde überwinden? Ist das möglich? Ist das sinnvoll und reif? Muss das Fremde verwandelt werden, soll man es sich einverleiben? Warum dürfen Fremdheiten nicht bestehen bleiben? Warum darf das Fremde nicht fremd bleiben? Gibt es denn einen Zwang zum Vertrauten?
In meinem eigenen Verständnis ist das Phantasma einer primären Ungeschiedenheit (ich bin eins mit mir) Ausdruck einer regressiven Fantasiebildung, wie der Schlaf, wie der Rausch oder andere Befriedigungen, die eine subjektive Bestätigung erfahren.
Das erlebensfremde Element unterbricht nämlich einen Erregungsablauf, der auf beglückende Übereinstimmung abzielt. Das Subjekt, der Initiator einer Initiative wird auf sich selber zurückgeworfen, es entsteht eine rudimentäre Schamsituation, ein basales Gefühl von Unstimmigkeit, von Schlechtigkeit, ein archaisches Schuldgefühl.
Das Fremde in mir zu entdecken und zu belassen ist voller Ambivalenz. Einerseits ist die Erfahrung des Fremden psychisch überlebensnotwendig, denn es ermöglicht mir durch meine Reflexion auf meinen eigenen Ausgangspunkt, das zu entwickeln, was man später als Selbst bezeichnet. Gleichzeitig ist das Fremde aber auch Repräsentant des Bruches der Ungeschiedenheit und des Verlustes einer paradiesischen Verbundenheit mit dem Universum.
Die Welt der Übereinstimmung wird gestört durch das Auftauchen des Anderen/des Fremden. Paradigmatisch hierfür ist die Konstellation der Fremdenangst. Vorher bestehende Unlusterfahrungen können jetzt als fremdes Gesicht erachtet werden. In Folge kommt es zu einer Tendenz der Egalisierung und Desymbolisierung. Alles Besondere, Individuierte, Differenzierte, alles Kranke, Schwache, Behinderte, alles Andere, Fremde fällt der Tendenz der Uniformierung anheim. Die für das psychische Überleben des Subjektes unersetzbare Funktion des unterscheidbaren Fremden führt dazu, dass ein fremdes Gegenüber ständig als solches generiert werden muss.
Darf es keine Austauschbeziehung im äußeren Raum mit der Akzeptanz und Anerkennung des Fremden geben, gelangt man kaum zu einer symbolisch vermittelten Strukturbildung im Inneren. Grenzüberschreitungen und Zerstörungen tauchen auf und alle Formen der Verachtung, des Hohns, des Spotts, des Zynismus, der Entwertung.
Die Entfremdung zu mir selbst, wie schmerzhaft sie auch sein mag, verschafft mir eine wertvolle Distanz, aus der sowohl die perverse Lust als auch meine Möglichkeit zu imaginieren und zu denken erwachsen, der Impuls meiner Kultur.
In der Beschäftigung mit dem Fremden in der therapeutischen Beziehung taucht noch eine weitere brisante Frage auf, ob es möglich ist, ein anderer zu sein. Es geht nicht darum, den anderen zu akzeptieren, sondern darum, an seiner Stelle zu sein und das heißt, sich als anderer selbst zu denken und zu verhalten.
Können wir überhaupt innerlich, subjektiv mit den anderen, können wir die anderen (er)leben? Ohne Ächtung, aber auch ohne Nivellierung. Sind wir fähig, Formen des Andersseins zu akzeptieren?
Finden wir in uns eine Bereitschaft, das Fremde nicht im Außen zu verfolgen, sondern in uns aufzuspüren?
Natürlich benötigen wir Mut, uns selbst als desintegriert zu benennen, damit wir das Fremde nicht einfach nur vereinnahmen oder verfolgen, sondern dieses Unheimliche, diese Fremdheit aufnehmen, die ebenso dort wie hier, draußen wie innen, die die unsrige ist. Das bedeutet, dass wir das Fremde nicht verdinglichen, sondern es analysieren, indem ich wir uns analysieren, eine Aufforderung, unsere unerklärliche Andersheit zu entdecken, denn sie ist es, die uns angesichts dieses Dämons, dieser Bedrohung, dieser Unruhe überfällt, sie erzeugt die projektive Erscheinung des anderen innerhalb dessen, was wir hartnäckig als ein eigenes und festes „wir“ aufrechterhalten. Wen wir unsere Fremdheit erkennen, werden wir draußen weder unter ihr leiden noch sie genießen. Das Fremde ist in mir, also sind wir alle Fremde. Vielleicht gelingt es, dass wir uns wechselseitig in unserer Schwäche helfen, einer Schwäche, deren anderer Name unsere radikale Fremdheit ist.
Vielleicht geht es auch darum, den Begriff des Fremden um das Recht auf Respekt unserer eigenen Fremdheit und des Privaten, zu erweitern.
Die Ethik der Psychoanalyse enthielte dann einen Kosmopolitismus neuer Art, der an einer Menschheit arbeitet, deren Solidarität in dem Bewusstsein ihres Unbewussten gründet- einem Unbewussten, das begehrend, fremd, zerstörerisch, ängstlich, leer, unmöglich ist.
Wie lässt sich dieser Denkansatz in der Behandlung umsetzen?
Die analytische Behandlungstechnik bietet verschiedene Modelle an. Alle beinhalten eine relativ geordnete perspektivische Sicht, lassen sich theoretisch ableiten und begründen und befassen sich mehr oder weniger akzentuiert mit Fremdheiten.
Uns allen bekannt ist das lebensgeschichtlich-infantile Modell. Dabei werden die Äußerungen des Patienten überwiegend aus seinem lebensgeschichtlichen Kontext verstanden und interpretiert. Dieses traditionelle Vorgehen spielt aus meiner Sicht in der modernen Behandlungstechnik keine zentrale Rolle mehr. Besonders verhängnisvoll kann es dann werden, wenn Patienten und auch Therapeuten sich dazu verleiten lassen, den Patienten auf seine Lebensgeschichte festzunageln.
Ein anderes Modell legt besonderen Wert auf die Artikulation intrapsychischer Welten, auf die inneren Objekte und Fantasien. Hierzu rechne ich die primäre psychoanalytische Behandlungstechnik und den Ansatz von Melanie Klein.
Ein weiteres behandlungstechnisches Modell stellt die Bedeutung und Erfassung interpersoneller Aspekte in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Das Deutungsverständnis wird gewonnen aus der aktuellen Analytiker-Patient-Beziehung und dessen Kontext. Dieses Modell ist heute weit verbreitet. Es hat sich auf dem Boden der Objektbeziehungstheorie entwickelt. Für manche Patientin, insbesondere diejenigen, die früh gestört sind oder unter heftigen Schamaffekten leiden, kann die Fokussierung auf diese behandlungstechnische Variante zu Schuld- und Verfolgungsfantasien führen, die sich in Rückzug und Verweigerung ausdrücken können (siehe auch schizoide Abwehr, John Steiner: Orte des seelischen Rückzuges oder meinen Vortrag aus 2007).
Ferro schlägt ein anderes psychoanalytisches Dekodierungsmodell vor. Der Ausgangspunkt des Zuhörens ist gekennzeichnet durch eine Nicht-Festgelegtheit. Alle möglichen Geschichten sind Ausgangspunkt der Technik und werden auf der Grundlage eines narrativen Zusammenhanges verstanden.
(Gerhard) Schneider hat diesen Ansatz erweitert. Er meint, dass der Analytiker eine aporetische, eine unmögliche Position innehat. Damit hat er eine zurzeit sehr aktuelle und interessante Diskussion ausgelöst. Überspitzt ausgedrückt bedeutet die aporetische Position, dass das Analysieren eigentlich unmöglich ist. Analytische Arbeit besteht darin, das Analysieren erst möglich zu machen. Vielen Patienten ist der Analytiker zunächst ein Fremder, ein Nichtgreifbarer, eine Art virtueller Analytiker. Auch der eigene psychische Innenraum mit seinen potentiellen Bedeutungen ist dem Patienten zunächst unbegreiflich, irgendwie bloß virtuell, nicht wirklich ernsthaft vorhanden, sondern muss erst entstehen. Von virtuell spricht Schneider deshalb, weil es diesen psychischen Raum und diesen Analytiker in der Realitätserfahrung zunächst nicht gibt, selbst bei körperlichen Schmerzen oder Symptomen ist die psychische Dimension für den Patienten zunächst nicht begreifbar. Daher liegt der Schatten des virtuellen über der Analyse und wird nur langsam durch das Erlebte als Wahrheit erfahren. Schneider (wie auch Steiner) weisen daraufhin, dass das Analysieren selbst Patienten ab einem bestimmten Punkt in elementarer Weise bedrohen kann, weil für sie die Gleichung "erkannt werden = vernichtet werden“ besteht. Da die Analyse auf das Verstehen ausgerichtet ist, kann sich bei diesen Patienten ein Nicht-Weiter-Kommen einstellen, eine Aporie (Ausweglosigkeit) oder eine aporetische Situation. In solchen Situationen wird die Existenz des Analytikers als Analytiker zum Problem, weil das, was ihn ausmacht, nämlich das Analysieren, erschüttert ist.
Kollusive Verstrickung ist ein unvermeidbarer Teil des analytischen Prozesses. Schneider glaubt, dass der Analytiker nur weiterkommt, wenn er bereit ist, seine Position aufzugeben. Für den Analytiker wird das psychisch erfahrbar durch ein Angstgefühl, sich zu verlieren, weil der Patient dem Analytiker eine Rolle zuschreibt, die dieser ganz einnehmen soll. Sperrt sich der Analytiker gegen eine dem Analysanden analoge Regression, kann es zu Schwierigkeiten in der Behandlung kommen.
Die therapeutische Beziehung hat eine Besonderheit, sie ist darauf gerichtet, das Fremde bei sich und beim Anderen zu entdecken. (Siehe dazu auch Bollas und Mitchell). Dafür benötigen Patient und Therapeut eine besondere Form der Bezogenheit, die das jeweilige Anderssein und das Fremde einschließt, sowohl das des Anderen wie das des Eigenen. Diese Art der Offenheit und Bezogenheit bezeichnet man als Transgression.
Landis weist in einem Kommentar auf die Aporie-These von Schneider darauf hin, dass die psychoanalytische Methode eine Technik und eine Kunst sei und somit logisch und schöpferisch zugleich. Der Widerstand, sei er nun individueller innerer oder gesellschaftlicher äußerer Natur, gehöre essentiell zur Analyse. Der Analytiker solle sich nicht auf ein oder das methodisches Vorgehen konzentrieren, sondern solle sich in die dialektische schöpferische Beziehung hineingeben. Man müsse den Patienten in seinem Umfeld (mit seinem Werten, Lebensform) anerkennen und beide (Patient und Analytiker) sollten sich von dem Prozess erfassen und verwandeln lassen. Das Vertrauen auf den schöpferischen Akt, auf die eigene sowie auf die schöpferische Potenz des Patienten/des Paares ist das eigene Andere der psychoanalytischen Behandlungstechnik, das heißt die immer gegenwärtige notwendige Negation der Technik.
Vorraussetzung für den transformativen oder transgressiven Prozess ist zunächst die Schaffung eines Seelenraumes, in dem sich Fremdes zeigen kann, bei aller Scham, Angst und Abwehr. Voraussetzung für die Entdeckung dieses Seelenraumes, in dem das Schreckliche sein kann, sich gestalten darf, ist die transgressive Bereitschaft des Therapeuten. Damit vollzieht sich eine Wandlung, die auch den Körper erfasst, der so wieder langsam zum eigenen werden kann, er wird reanimiert, reaktiviert und als leibliche Präsenz verstanden. Danach wird der Beziehungsraum entdeckt. Der andere wird erfahren, das Fremde des anderen und das Fremde des Eigenen erhalten Bedeutung und werden anerkannt. Diese Wandlung ist für mich immer wieder ein sehr berührender Teil der Behandlung.
Transformative Prozesse sind dynamischer Natur und unterliegen einer naturhaften Bewegung, die ich am ehesten mit einer Welle vergleiche.
Ohne beiderseitige Einlassung, ohne beiderseitige Bezogenheit, ohne Transgression kann es aus meiner Sicht nur schwer ein Verstehen, Nähe, Veränderungssog, Erkenntnis und letztendlich Heilung geben, in der die unfassbaren Fremdheiten eine anerkannte potente Existenz erhalten.